Kommunikationsformen
Musik
Jazz, Blues, Rap oder brasilianischer Samba: Musik ist das
häufigste Mittel der so genannten Unterschicht, ihre
Lebensart zu publizieren und zu verteidigen. Analphabetismus oder
kollektive Tätigkeit, egal, Musik schafft den Zugang zu
nahezu allen sozialen Schichten. Wer gehört wird, kann was
verändern.
Unter der Diktatur (bis 1972) entwickelt sich eine musischen
Protestbewegung, deren Anfänge in der Musikszene mit
Sängern wie Joao Gilberto, Caetano Veloso und Maria Methania
zu hören sind. Die Leichtigkeit des BossaNova, mit den
lyrischen Texten vom einfachen Leben der Menschen, der in Kneipen
wie öffentlichen Plätzen gespielt wird, verweigert sich
jeder Vereinnahmung durch die Politik der Machthaber und wirkt
dadurch erst recht subversiv.
"Meinungsfreiheit/ Lass mich reden, Hurensohn,/ Meine Meinung//
Meinungsfreiheit macht eine Nation aus/ Nicht Geld oder sein Gegenwert//
Hört genau zu, was ich zu sagen hab’/ Bewusstsein und Auflehnung ist das, was ich brauch’/ Denn mein Kopf verlangt nur HxCx und Reggae/ Die Message kommt von der Straße, da gibt’s nichts zu verstecken/ Mein Geheimnis lautet, ich bin ohne Furcht/ Es lohnt sich nicht zu leben, wenn ich nicht sagen kann, was ich will/ Ob richtig oder falsch, offen oder verdeckt,/ Nur wer den Rhythmus des Calango spürt, wird sich verändern"
Musik übernimmt die Funktion der unabhängigen Presse
und ist Vorläufer des Lokalradios. In den Siebziger Jahren
verschärft sich der Widerstand der Favelados, sie etablieren
sich in durchstrukturierten Organisationen. Lautsprecheranlagen
werden in verschiedenen Favelas installiert. In ‚Nova
Brasil’ las José, einer der Initiatoren der
AMBNB
jeden Abend aus der Zeitung vor, berichtete über die
nächsten Schritte der Organisation und bat um Mithilfe
für Demonstrationen etc.
Heutzutage zählt man pro Favela durchschnittlich ein
Lokalradio; im Zentrum gibt es zum Teil doppelt so viele Radios
pro Favela, die (inter)national zusammenarbeiten.
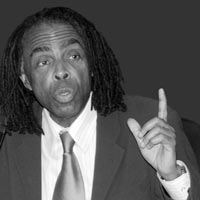 In Brasilien kein Wunder, dass Präsident Luiz Inacio Lula da
Silva 2003 dem zweiundsechzigjährigen Musiker und gelernten
Unternehmensberater Gilberto Gil den Posten des Kultusministers
anbot. Gil will nun den Samba als Weltkulturerbe vermarkten. Doch
damit nicht genug: Rapper aus Megastädten wie Rio und Sao
Paulo arbeiten erstmals mit den traditionellen Repentista-Duos
des Nordostens zusammen, die gereimten Wechselgesang aus dem
Stegreif abfeuern; in Amazonien werden CDs von Künstlern
direkt produziert und vertrieben, die andernfalls keinerlei
Marktchancen hätten; Brasilien soll endlich ein
Karnevalsmuseum erhalten; schon im letzten Jahr sollten die
ersten zwanzig Kulturzentren namens BAC = ‚Base de Apoio
à Cultura‘ (Stützpunkt zur
Kulturförderung) in Armenvierteln aus Fertigbauteilen
errichtet werden. Allerdings kam der Minister deswegen in
Schwierigkeiten. Was ihn zwang, fast sein gesamtes
Führungsteam auszutauschen. Für Monate blieb das
Kulturressort quasi gelähmt und die Krise ist bis heute
nicht überwunden.
In Brasilien kein Wunder, dass Präsident Luiz Inacio Lula da
Silva 2003 dem zweiundsechzigjährigen Musiker und gelernten
Unternehmensberater Gilberto Gil den Posten des Kultusministers
anbot. Gil will nun den Samba als Weltkulturerbe vermarkten. Doch
damit nicht genug: Rapper aus Megastädten wie Rio und Sao
Paulo arbeiten erstmals mit den traditionellen Repentista-Duos
des Nordostens zusammen, die gereimten Wechselgesang aus dem
Stegreif abfeuern; in Amazonien werden CDs von Künstlern
direkt produziert und vertrieben, die andernfalls keinerlei
Marktchancen hätten; Brasilien soll endlich ein
Karnevalsmuseum erhalten; schon im letzten Jahr sollten die
ersten zwanzig Kulturzentren namens BAC = ‚Base de Apoio
à Cultura‘ (Stützpunkt zur
Kulturförderung) in Armenvierteln aus Fertigbauteilen
errichtet werden. Allerdings kam der Minister deswegen in
Schwierigkeiten. Was ihn zwang, fast sein gesamtes
Führungsteam auszutauschen. Für Monate blieb das
Kulturressort quasi gelähmt und die Krise ist bis heute
nicht überwunden.
Behindert sieht sich die weltweite Vermarktung brasilianischer
Musik auch aufgrund fehlender Kulturabteilungen in den
Botschaften. Das will Gilberto Gil rasch ändern; womit er
eindeutig auf die politische Dimension von Musik verweist.
Da jede Musikrichtung für eine bestimmte Lebensphilosophie
steht, zu der Kleidung, Gehabe, Denkweise, Freunde und Feinde
gehören, wird hier eine Auflistung nach Genre gemacht. Samba
und Carnaval sind die Prototypen der Protestaktionen. Ab den
Achtzigern kommen drei weitere Genres hinzu: HipHop, AfroReggae
und BaileFunk.
Auszug des Liedes Deixa eu falar von Raimundos, 2005
Associação dos Moradores do Bairro de Nova Brasília